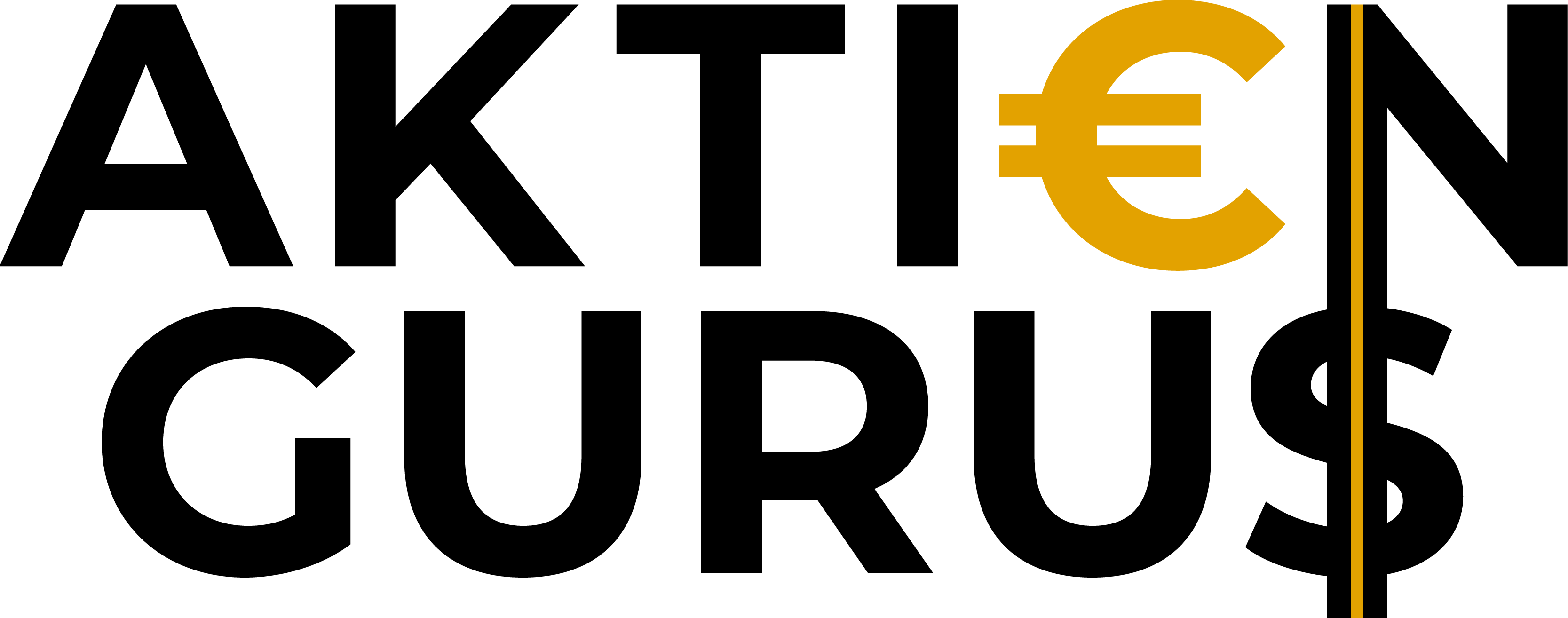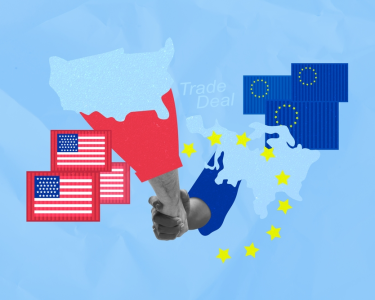EU einigt sich auf neuen CO₂-Handel für Verkehr und Gebäude
In Brüssel ringen die Staats- und Regierungschefs um Entscheidungen, die für Millionen Bürger in Europa spürbare Folgen haben werden. Im Mittelpunkt steht die Einführung des neuen Emissionshandelssystems ETS 2, das ab 2027 gelten soll. Dieses System wird erstmals auch die Bereiche Heizen und Verkehr einbeziehen und fossile Brennstoffe wie Gas, Öl, Benzin und Diesel mit einem europaweiten CO₂-Preis belegen.
Das Ziel der Reform ist ehrgeizig: Europa soll den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich senken und bis 2040 auf einen Pfad zur Klimaneutralität gebracht werden. Doch die Umsetzung spaltet die Mitgliedsstaaten – zwischen den Forderungen nach Klimaschutz und der Sorge vor massiven Mehrkosten für Verbraucher.
Deutschland drängt auf Start im Jahr 2027
Während Länder wie Polen und Tschechien eine Verschiebung bis 2030 anstreben, will Deutschland am ursprünglichen Zeitplan festhalten. Laut dem Koalitionsvertrag soll der Übergang vom nationalen Emissionshandel in das europäische System „fließend“ erfolgen.
Bereits seit 2021 erhebt Deutschland einen eigenen CO₂-Preis, geregelt im Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Dieser steigt bis 2025 schrittweise auf 55 Euro pro Tonne CO₂. Ab 2026 folgt ein Auktionsmodell mit einem Preiskorridor von 55 bis 65 Euro, bevor 2027 das ETS 2 greift.
Die neue Regelung unterscheidet sich vom bisherigen Industriesystem: Es gibt keine kostenlosen Zertifikate mehr – alle Emissionen müssen vollständig versteigert werden. Die daraus entstehenden Kosten werden zwangsläufig an die Endkunden weitergegeben.
Haushalte müssen mit höheren Preisen rechnen
Für Verbraucher bedeutet die Neuregelung deutliche Mehrbelastungen beim Heizen und Tanken. Energieversorger und Mineralölkonzerne müssen CO₂-Zertifikate erwerben, deren Preis sie an ihre Kunden weiterreichen. Nach Einschätzung von Analysten könnte sich der Preis pro ausgestoßener Tonne CO₂ zunächst zwischen 45 und 65 Euro bewegen.
Haushalte mit Öl- oder Gasheizung werden stärker betroffen sein als Nutzer von Wärmepumpen oder Fernwärme. Auch Autofahrer spüren die Folgen an der Zapfsäule. Schon heute zeigt sich, dass der nationale CO₂-Aufschlag in Deutschland die Kraftstoffpreise um mehrere Cent pro Liter erhöht.
Bundeskanzler Friedrich Merz betonte in Brüssel: „Klimaschutz muss sozialverträglich bleiben – aber er darf nicht aufgeschoben werden.“
Mechanismen gegen extreme Preissprünge
Um eine Preisexplosion zu verhindern, hat die EU automatische Stabilisierungsmaßnahmen vorgesehen. Wenn der Preis für Zertifikate über 45 Euro pro Tonne steigt und zwei Monate lang anhält, werden 20 Millionen zusätzliche Emissionsrechte freigegeben. Steigt der Preis auf das Doppelte des Durchschnitts der letzten sechs Monate, erhöht sich die Zahl auf 50 Millionen, bei einer Verdreifachung sogar auf 150 Millionen.
Eine sogenannte Marktstabilitätsreserve (MSR) soll verhindern, dass sich starke Preisausschläge langfristig verfestigen. Länder wie Österreich, Spanien und Deutschland fordern derzeit, die Schwellenwerte flexibler zu gestalten, um kurzfristig reagieren zu können. Diese Regelung gilt als entscheidend, um Akzeptanz für das System zu schaffen.
Frühversteigerungen und Klimafonds geplant
Mehrere Mitgliedsstaaten schlagen vor, den Zertifikathandel schon Mitte 2026 zu starten, um Planungssicherheit für Energieunternehmen und Haushalte zu schaffen. Durch solche „Frühauktionen“ ließe sich der Marktpreis frühzeitig stabilisieren. Ein internes EU-Dokument verweist darauf, dass dies „die Transparenz erhöhen und Preisspitzen vermeiden“ könne.
Zur sozialen Abfederung wird ein Europäischer Sozialklimafonds eingerichtet. Ab 2026 sollen bis 2032 Gelder fließen, um energetische Sanierungen, klimafreundliche Heizungen, öffentliche Verkehrsmittel und Direktzahlungen an einkommensschwache Haushalte zu fördern. Dieser Fonds gilt als zentrales Instrument, um den Übergang zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft sozial gerecht zu gestalten.
Klimaziel 2040 sorgt für politischen Streit
Neben dem ETS 2 steht auch das künftige EU-Klimaziel für 2040 im Fokus. Die Europäische Kommission will die Emissionen um 90 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Wissenschaftliche Gremien fordern sogar Einsparungen von bis zu 95 Prozent, ohne den Rückgriff auf internationale Ausgleichszahlungen.
Die politische Einigung gestaltet sich schwierig: Im September 2025 scheiterte ein Kompromiss der Umweltminister. Nun liegt die Entscheidung bei den Staats- und Regierungschefs. Der Ausgang gilt als richtungsweisend für die europäische Energie- und Wirtschaftspolitik der kommenden Jahre.
Friedrich Merz steht dabei zwischen zwei Fronten – dem internationalen Druck, ehrgeizige Klimaziele umzusetzen, und dem innenpolitischen Anspruch, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu sichern. Seine jüngste Regierungserklärung brachte diese Spannung auf den Punkt: „Wir müssen das Klima schützen, ohne unsere industrielle Basis zu gefährden.“
Teurer Wandel in Richtung Klimaneutralität
Mit dem Start des ETS 2 und den parallel beschlossenen Zielen für 2040 wird Europa einen tiefgreifenden Strukturwandel erleben. Ob der Übergang gelingt, hängt davon ab, wie stark sich die Energiepreise, die sozialen Ausgleichsmaßnahmen und die Investitionsbereitschaft der Industrie gegenseitig beeinflussen. Klar ist: Die Weichen, die jetzt gestellt werden, bestimmen nicht nur die Klimapolitik, sondern auch die Lebenshaltungskosten der kommenden Jahre.