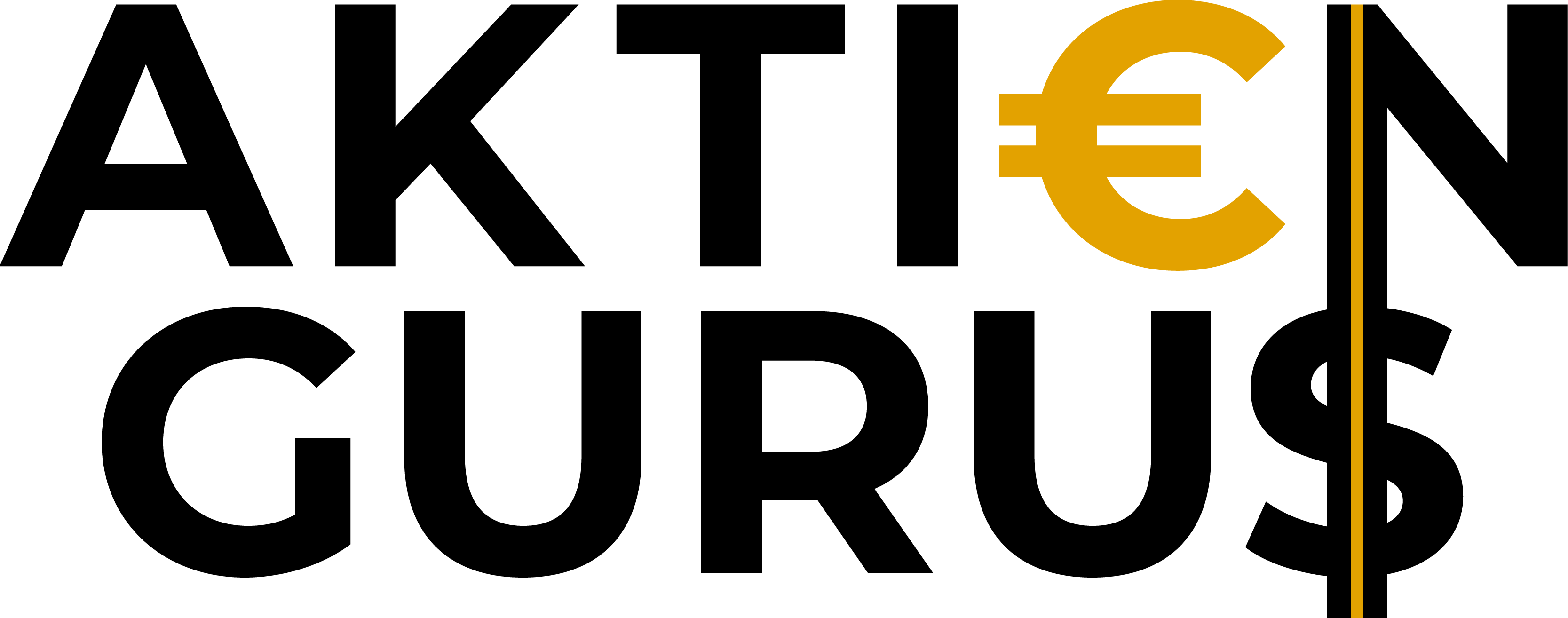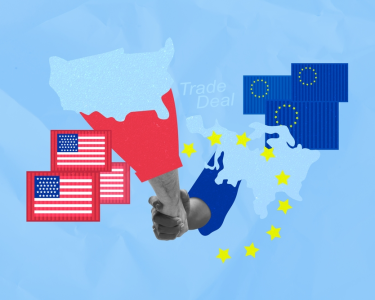Eine alarmierende Zahl von Frauen in Deutschland ist finanziell nicht ausreichend abgesichert. Laut einer aktuellen Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) kann fast die Hälfte der erwerbstätigen Frauen langfristig nicht von ihrem eigenen Einkommen leben. Dies betrifft insbesondere Frauen in Teilzeit und mit niedrigeren Löhnen.
Finanzielle Unsicherheit durch ungleiche Erwerbsverhältnisse
Die Studie zeigt, dass 53 Prozent der erwerbstätigen Frauen nicht genug verdienen, um sich über den gesamten Lebensverlauf hinweg selbst zu versorgen. Auch in Lebensphasen wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder im Ruhestand sind sie finanziell unzureichend abgesichert. Besonders besorgniserregend ist, dass 70 Prozent der erwerbstätigen Frauen nicht einmal genug verdienen, um sich selbst und ein Kind langfristig zu versorgen.
Ein zentraler Grund für diese Problematik ist die ungleiche Verteilung von Erwerbsarbeit und familiären Verpflichtungen. Frauen unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer, besonders durch die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen. Zudem sind viele Frauen in Teilzeitbeschäftigung, was zu einem niedrigeren Einkommen führt. Im Durchschnitt verdienen Frauen rund 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, was ihre finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge beeinträchtigt.
Teilzeit und Lohnungleichheit als Barrieren
Ein erheblicher Teil der Frauen arbeitet in Teilzeitjobs, die häufig schlecht bezahlt sind und keine existenzsichernde Einkommensquelle bieten. Diese Frauen haben oft mit Einkommenslücken und einer geringeren Rentenversorgung zu kämpfen. Zudem sind ihre beruflichen Perspektiven im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen eingeschränkt, die häufiger in Vollzeitjobs arbeiten.
Die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen trägt weiter zur Benachteiligung bei. Frauen haben nach wie vor schlechtere Aufstiegschancen und verdienen insgesamt weniger als ihre männlichen Kollegen, was langfristig auch ihre Rentenansprüche schmälert.
Ungleiche Verteilung der Familienarbeit
Die ungleiche Verteilung von Haushalts- und Pflegeaufgaben trägt ebenfalls zur finanziellen Benachteiligung von Frauen bei. In vielen Familien ist es immer noch der Mann, der das Haupteinkommen verdient, während die Frau für die Kinderbetreuung und den Haushalt zuständig ist. Diese traditionelle Rollenverteilung hat zur Folge, dass Frauen beruflich weniger gefördert werden und ihr Einkommen und ihre Rentenansprüche langfristig verringert werden.
Forderungen zur Verbesserung der Situation
DGB-Vizechefin Elke Hannack bezeichnete die Ergebnisse der Studie als „erschreckend“ und fordert eine gerechtere Verteilung der Verantwortung in Familien und bei der Pflege von Angehörigen. Sie betont, dass dringend mehr in öffentliche Kita-Angebote investiert werden muss, um die Erwerbsfähigkeit von Frauen zu fördern. Zusätzlich fordert sie eine stärkere Beteiligung der Väter an der Sorgearbeit, etwa durch den Ausbau der Partnermonate beim Elterngeld und eine bezahlte Freistellung für den zweiten Elternteil rund um die Geburt eines Kindes.
Die Studie des DGB zeigt deutlich, dass es noch viele Hürden auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit und Gleichstellung von Frauen gibt. Es müssen daher dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Situation zu verbessern und die Gleichberechtigung im Berufsleben zu fördern.