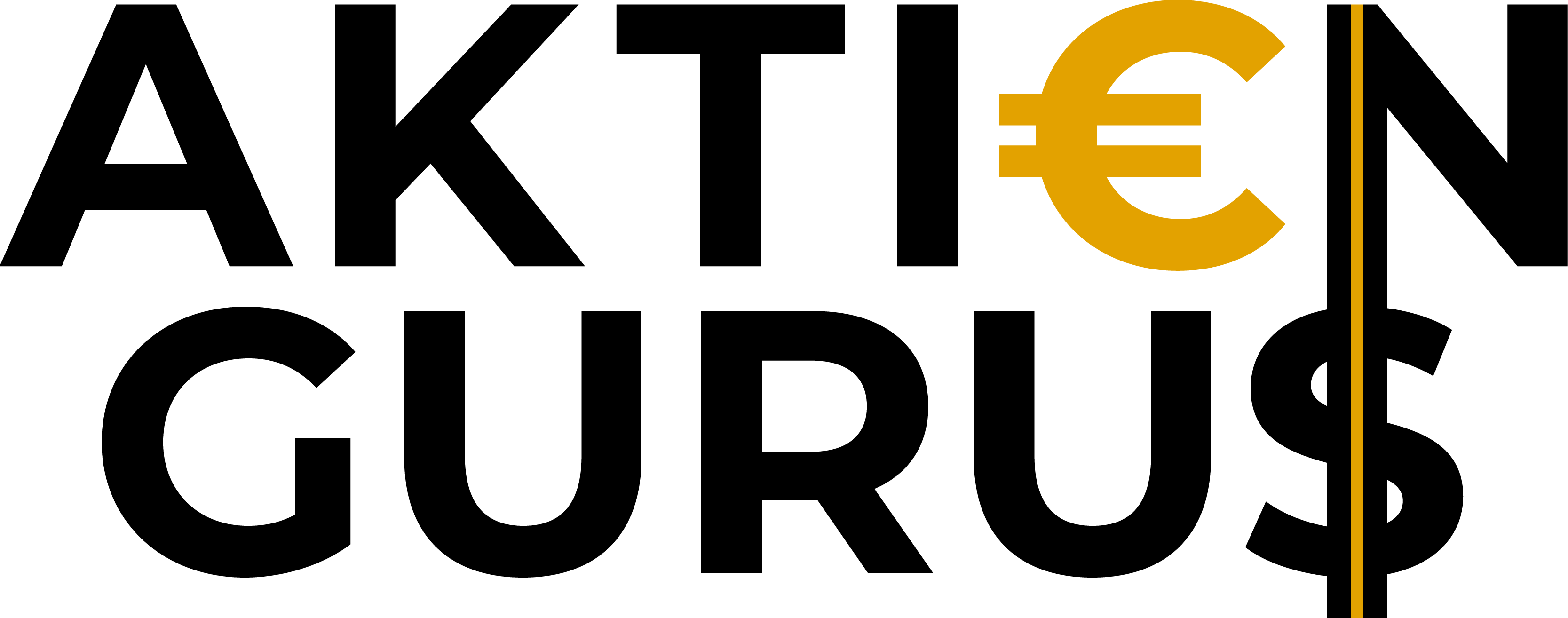Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD schreiten voran, und erste interne Papiere zeigen, wohin die Reise geht. Besonders die Sozial- und Migrationspolitik stehen im Fokus der geplanten Veränderungen.
Bürgergeld vor einer grundlegenden Reform
Ein zentrales Thema ist die geplante Umgestaltung des Bürgergelds. Die Koalitionäre wollen nicht nur den Namen ändern, sondern auch strengere Bedingungen einführen. Arbeitslose sollen künftig nachweisen müssen, dass sie sich aktiv um eine Beschäftigung bemühen.
„Die Arbeitsämter sollen nicht mehr hinter den Arbeitssuchenden herlaufen, sondern lediglich Unterstützung anbieten“, heißt es in dem Verhandlungspapier. Wer zumutbare Arbeit mehrfach ablehnt, soll mit einem vollständigen Leistungsentzug rechnen müssen. Diese Maßnahme wird jedoch an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts angepasst.
Ein weiterer Einschnitt betrifft das Vermögen der Antragsteller. Die bisherige Regelung, die eine Schonfrist gewährt, entfällt. Wer über Ersparnisse verfügt, muss diese zuerst aufbrauchen, bevor staatliche Leistungen gezahlt werden. Zudem sollen die Behörden mehr Möglichkeiten zur Überprüfung finanzieller Verhältnisse erhalten.
Migrationspolitik: Striktere Regeln geplant
Neben der Sozialpolitik rückt auch die Migration in den Mittelpunkt der Koalitionsgespräche. Union und SPD wollen die Begrenzung der Migration wieder explizit im Aufenthaltsgesetz verankern. „Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen“, heißt es in dem Papier.
Ein besonders umstrittener Punkt ist der Familiennachzug. Die Fachpolitiker der Koalitionsparteien haben sich darauf verständigt, diesen für subsidiär Schutzberechtigte für zwei Jahre auszusetzen. Härtefälle sollen jedoch weiterhin berücksichtigt werden.
Darüber hinaus wird eine Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten angestrebt. Algerien, Indien, Marokko und Tunesien sollen als sichere Staaten eingestuft werden, was die Abschiebungen erleichtern würde.
Sicherheitspolitik: Höhere Verteidigungsausgaben geplant
Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zeichnen sich deutliche Veränderungen ab. Deutschland soll als zentrale NATO-Drehscheibe ausgebaut und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr erhöht werden. „Die massive Bedrohungslage gebietet eine glaubwürdige Abschreckung“, heißt es im Arbeitspapier der Koalitionäre.
Die Frage der Wehrpflicht bleibt jedoch strittig. Während die Union für eine Wiedereinführung plädiert, setzt sich die SPD für ein freiwilliges Modell ein. Auch die Höhe der Verteidigungsausgaben ist umstritten. CDU und CSU fordern eine Anhebung auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während die SPD hier keine klare Position bezieht.
Klimapolitik: Kohleausstieg wird verschoben
Auch in der Klimapolitik gibt es Kursänderungen. Union und SPD haben sich darauf geeinigt, den Kohleausstieg nicht wie ursprünglich geplant bis 2030, sondern erst bis spätestens 2038 umzusetzen. „An den beschlossenen Ausstiegspfaden für die Braunkohleverstromung bis spätestens 2038 halten wir fest“, heißt es im entsprechenden Papier.
Uneinigkeit besteht hingegen bei der Atomkraft. Während CDU und CSU die Kernenergie als wichtigen Baustein der Energiewende sehen, lehnt die SPD diese Position ab.
Die Verhandlungen zwischen Union und SPD sind noch nicht abgeschlossen, doch die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass zahlreiche Reformen auf den Weg gebracht werden – mit weitreichenden Konsequenzen für Bürgergeld-Empfänger, Zuwanderer und die deutsche Energiepolitik.